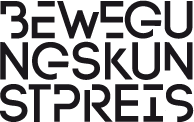Compania Sincara mit "TURANDOT".
Der 15. und letzte Leipziger Bewegungskunstpreis geht 2019 an Compania Sincara. Turandot, ein Maskenstück, das groß- und wichtigtuerisch, tänzerisch, mit Richtbeil und Mantel, bezauberndem Häubchen und einem Faible für guten Applaus das Publikum mit einer ganz eigenen Märchenversion auf seine Seite zieht. Herzlichen Glückwunsch!

Fotos (c) Thilo Neubacher.
Die Jury über den Preisträger des Leipziger Bewegungskunstpreises 2019
Am kalten Vorabend des Weihnachtsfestes 1915 hat die Redaktion einer wenig bekannten Petersburger Zeitschrift Post aus dem Jenseits erhalten. Graf Carlo Gozzi höchstpersönlich war dem finsteren Hades entstiegen, um sie zu besuchen und ein versiegeltes Manuskript auf dem Redaktionstisch zu hinterlassen. Auf den leicht vergilbten Seiten mit geschnörkeltem Schriftzug war die folgende Prophezeiung zu finden: »Ich habe die maßlos lange Reise in Ihre Stadt unternommen und bereue es nicht. Die schneebedeckten Plätze, die geradlinigen Straßen, die Skulpturen an vielen Häusern, der wunderbare Fluss – alles dies ist meinem Herzen lieb und entspricht meinem Geschmack und meinen Neigungen. Ich bitte Sie, sagen Sie Ihrem Theaterpublikum, dessen Augen von der neuen Art der Theaterbeleuchtung verdorben sind und vor dem die Komödianten bedeutungslose Stücke spielen, sagen sie ihm, Ihre Stadt ist zum Schaffen und Aufblühen einer szenischen Kunst bestimmt, an die man bei Ihnen nicht einmal zu denken wagt. Hier, wie nirgends sonst, können die Masken der italienischen Improvisations-Comödie erklingen, die ich so liebe und deren Rolle in der Blütezeit vieler Theaterepochen so bedeutungsvoll gewesen ist.« Und so begaben sich die Redakteure, wie es die Prophezeiung vorsah, auf die Spuren Gozzis, Theater-Magus im Besitz eines Zauberstabes, mit dem er einst »wilde Tiere in Versen sprechen, Fürsten auf Meeresungeheuern reisen und nussgroße Tränen vergießen« ließ.
Diese kleine Geschichte erschien in einem Heft, dessen Seiten selbst inzwischen vergilbt sind. Es ist das Journal des russischen Avantgarde-Regisseurs Vsevolod Meyerhold und trägt den Namen Die Liebe zu den drei Orangen nach dem Titel eines Theaterstückes des verehrten Zauberers. Noch heute kündet das Journal davon, wie es damals war, von der Wiederbelebung der Schauspieler-Traditionen nicht nur zu träumen, sondern diesen praktisch-experimentell nachzugehen. Können die Traditionen aber, wenn die Pflanze einmal verkümmert ist und die Früchte verdorrt sind, in der neuen Gegenwart überhaupt wieder wachsen? Wie schwierig eine Antwort darauf ist und wie viel Arbeit sie macht, ist dem an diesem Abend prämierten Theaterkollektiv mehr als bewusst.
Nicht Orangen, wohl aber Zitronen rollten über den Boden der Schaubühne Lindenfels als Premierengabe, während die erste Vorstellung von TURANDOT. Ein Theatermärchen. Frei nach Carlo Gozzi mit begeistertem Applaus zu Ende ging. In Leipzig, einer Stadt mit Skulpturen an vielen Häusern und dem wunderbaren Fluss, in Zeiten, in denen die Plätze allerdings schon länger keine weiße Weihnacht mehr erlebt haben. Soeben waren Truffaldino, Pantalone, Dottore, Brighella und Capitano noch da: fremd-vertraute Figuren, denen sich die Compania Sincara im Laufe ihrer Proben auf sinnlich-physische und musikalische Weise genähert hatte. Gerade noch haben sie Bertolt Brechts und Hanns Eislers Kinderhymne ihre Stimmen geliehen ebenso wie ihre andersartige Perspektive auf diese Welt, und schon sind sie mit dem Erlöschen der Bühnenlichter und den verbliebenen, in der Tiefe des Raumes verhallenden Klavierakkorden wieder verschwunden. Es dämmerte im Saal, das Licht kam zurück, aber scheinbar nur, um uns zu zeigen, wie verlassen eine Bühne doch sein kann. Etwas Wehmut mischte sich in den Beifall, darüber, dass es vorbei war: vorbei die Fülle, die Kontaktfreude und Offenheit des Spiels, womit die eigentümlichen Spottvögel für eine Stunde Erdenzeit die Regentschaft übernommen hatten.
»Wen interessiert, ob Turandot den Prinzen Kalaf liebt oder nicht?«, schrieb Evgenij Vachtangov, der wie Meyerhold auf der Suche nach der schauspielerischen Meisterschaft war und dabei ebenso Gozzi als Vermittler wählte. Nicht einfach den Inhalt des Märchens sollten die Akteure seines Studios den Zuschauern vorführen, vielmehr ihr zeitgenössisches Verhältnis zu dem Stück. Es wertschätzen, aber auch lernen, ihre Ironie, ihr Lächeln einzubringen – über das Schreckliche und Tragische, von dem die eigentlich persische Erzählung über die gestrenge Prinzessin handelt. Dass er dabei – und ihm gleichsam zurufend die Compania Sincara – nicht Schillers Nachdichtung, sondern die Originalvorlage von 1762 vorzog, hatte Methode. Ging und geht es doch um Möglichkeiten der Rückgewinnung von Verfahren und Spielweisen, um das Trainieren von Fertigkeiten der Verwandlung und Improvisation.
Nun ist es ein besonderes Vergnügen zu sehen, wie die Compania die Trainingssituation selbst zum beweglichen Spielball der Aufführung macht: So stellt etwa Brighella zur Schau, inwiefern er mit einer glaubwürdigen Verwandlung seine Probleme hat. In einen schönen blauen Umhang gehüllt versucht er sich mehr schlecht als recht in der Pose des Prinzen, bemüht um ein paar Brocken Französisch. Schon die andere Rolle, Chef des Dienstpersonals am kaiserlichen Hof, hatte er zu beschwerlich gefunden. Und während man die mit abgeschlagenen Köpfen besetzte Halb-Mauer-halb-Stellwand hinter ihm im Blick hat, also auf mindestens dritter Imaginationsebene ahnt, in welche Gefahr er sich mit dieser Übung begibt, wischen Pantalone und Dottore seine kläglichen Ansätze großschnäuzig beiseite. Mit einander überbietenden Tipps und Tricks zeigen sie, wie es richtig geht, mit affektierter Geste oder aber natürlichem Auftreten zu beeindrucken – in der Kunst, in der Beziehung oder im Bewerbungsgespräch. Genussvoll betrügen sie Brighella um die ganze Nummer und treiben diese volltönend mit einem populären Stück Puccini-Musik, der Glanzarie des siegreichen Kalaf, auf die Spitze.
»Gesicht verlieren, um Gesicht zu zeigen«. Das ist ein Credo der Compania, welches schon für sich genommen eine Bastion des Alltags ins Wanken bringt: die gesellschaftliche Forderung nach Selbstidentität und Eindeutigkeit der Person, die aktuell, ausgestattet mit Big Data und Erkennungssoftware wie MegaFace und Clearview, durchaus antritt, sich zu einer bislang unbekannten Totalität aufzuschwingen. Es braucht in der Tat nur wenige Minuten nach Vorstellungsbeginn, um zu bemerken, wie kostbar und heilsam das Angebot ist, das uns hier und jetzt unterbreitet wird – ein Angebot, das unser Wahrnehmungspotenzial freisetzt, das unsere, um es mit dem Arabisten Thomas Bauer zu sagen, »Ambiguitätstoleranz« wieder zu nähren vermag. In Turandot wird nämlich gekonnt über Bande gespielt. Offensiv-materiell kokettieren die Masken mit dem Publikum, samt Kleid, Sprüchen und Bewegungskörper, nichtmenschlichen Kräften und Attributen. Der befiederte Capitano pickt eifrig jemandem aus der fünften Reihe einige Körnchen aus der Hand, bevor er zum todbringenden Richtbeil greift. Truffaldino, der uns artistisch versichert, dass er nicht ungeschickt sei, setzt sich prompt auf die Prinzessin und schafft damit versehentlich die beherrschende Macht im Staate ab. Und die Hauptperson des Stückes noch dazu. Eigens hervorzuheben ist dabei, dass es einer großen Handwerkskunst bedarf, um den Gesichtsmasken ihre Gestalt und solch wirksame Praxisfähigkeit zu verleihen.
Das Erstaunlichste und Wunderbarste am Projekt Turandot aber lässt sich am einfachsten sagen: Es funktioniert. So alt die Maskenfiguren und so rar gegenwärtige Kenner der dazugehörigen Erzähltechniken auch sind – das Publikum, und zwar ganz unterschiedlicher Jahrgänge und Hintergründe, versteht sie. Das ist weder begrifflich noch einseitig gemeint, hingegen als Lust sich wechselseitig zu verstehen, sich in direkter lebendiger Relation mit den Spielern zu verständigen: über Identitäten, Machtpositionen und vermeintlich zementierte Ordnungen. Benno Besson, ebenfalls ein Meister des Maskentheaters, formulierte es so: »Es ist die Kunst, zwischen diesen beiden Gemeinschaften [Akteuren und Publikum] unsere Wirklichkeit aufs Spiel zu setzen; damit zu spielen; damit hantieren, um sie handhaben zu können.« Hinzuzufügen bleibt: Auf dass wir weder Anmut noch Mühe, weder Leidenschaft noch Verstand im Umgang mit den Herausforderungen der Wirklichkeit sparen mögen. Die Jury gratuliert der Compania Sincara herzlich zum Bewegungskunstpreis 2019.